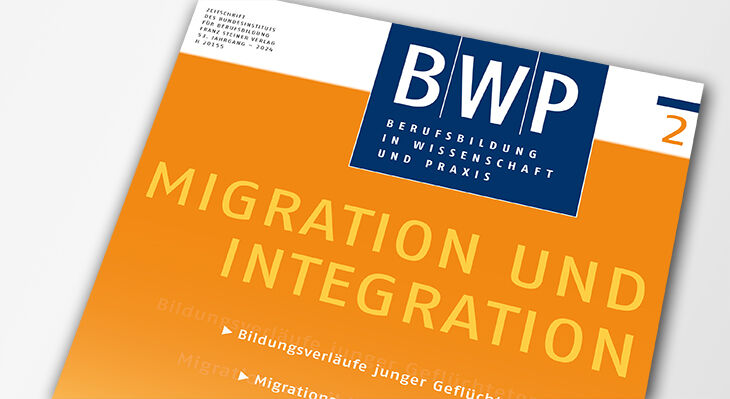Aktuelle Entwicklungen am Ausbildungsmarkt
Jugendliche, die sich für eine duale Berufsausbildung interessieren, müssen sich auf einem Markt orientieren und bewähren. Vergleichbares gilt für die Betriebe, die für ihre Ausbildungsplätze geeignete Bewerber suchen. Auf dem Ausbildungsmarkt entscheidet sich, wie gut es gelingt, jungen Menschen Lebensperspektiven zu eröffnen und Betriebe mit dem erforderlichen Fachkräftenachwuchs zu versorgen. Die Dauerbeobachtung der Entwicklungen am Ausbildungsmarkt ist daher eine wichtige bildungspolitische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Im Rahmen der jährlichen Ausbildungsmarktbilanzierung hat das BIBB eine zentrale Rolle: Die BIBB-Erhebung zum 30.9. ermittelt die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge bei den zuständigen Stellen. Aus diesen Daten und Daten der Bundesagentur für Arbeit zu unbesetzten Berufsausbildungsstellen und Bewerber/-innen, die zum Stichtag 30.9. noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind, werden Ausbildungsangebot und Nachfrage berechnet. Die Daten bilden die Grundlage der Berufsbildungsberichterstattung (§ 86 BBiG).
Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt immer zur Dezember-Sitzung des BIBB-Hauptausschusses. Dann erscheint auch ein Fachbeitrag zur Entwicklung des Ausbildungsmarktes (s. BIBB-Analysen zum Ausbildungsmarkt). Eine Vielzahl an Tabellen und Regionalkarten ist zudem auf den Internetseiten der BIBB-Erhebung zum 30.9. abrufbar.
Schaubild 1
Begriffe der Ausbildungsmarktbilanzierung
In Anlehnung an § 86 BBIG errechnet sich das Angebot an Ausbildungsstellen aus der Summe der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge (= erfolgreich besetzte Ausbildungsangebote) aus der BIBB-Erhebung zum 30. September sowie den bei der BA registrierten betrieblichen Berufsausbildungsstellen, die der Arbeitsverwaltung während des Berichtsjahres zur Vermittlung angeboten wurden und die zum Stichtag 30. September noch nicht besetzt waren (erfolgloses, unbesetztes Angebot).
Die Nachfrage errechnet sich als Summe der Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge (Quelle: BIBB-Erhebung zum 30.9.) plus allen bei der BA gemeldeten Bewerberinnen und Bewerbern, die zum Stichtag 30.9. noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind. Traditionell wurde die Nachfrage als Summe der Zahl der bis zum 30. September neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge und der Zahl der gemeldeten unversorgten Bewerber/-innen berechnet. Mit der traditionellen Nachfragedefinition wird die Zahl der ausbildungsuchenden jungen Menschen jedoch nicht vollständig abgebildet. Im Zuge der Berechnung der Nachfrage nach der erweiterten Definition werden jetzt alle Bewerber/-innen einbezogen, für die zum Stichtag 30.9. noch ein Vermittlungsauftrag in Ausbildung läuft. Das sind neben den (gänzlich) unversorgten Bewerber/-innen (ohne Alternative), auch die sogenannten „Bewerber/-innen mit Alternative zum 30.9.“ und weiterem Vermittlungswunsch in Ausbildung.
Die erweiterte Angebots-Nachfrage-Relation (eANR) zeigt an, wie viele Ausbildungsplatzangebote rechnerisch auf 100 Ausbildungsplatznachfrager/-innen entfallen.
Gemeldete Ausbildungsstellenbewerber/-innen, die sich im Laufe des Berichtsjahres für eine Alternative entschlossen (z. B. erneuter Schulbesuch, Studium, Erwerbstätigkeit, berufsvorbereitende Maßnahme) und am 30. September nicht mehr oder vorerst nicht mehr nach einer Berufsausbildungsstelle suchen, werden grundsätzlich nicht zu den Ausbildungsplatznachfragern/-nachfragerinnen gerechnet (d. h. auch dann nicht, wenn sie diese Alternative aufgrund erfolgloser Bewerbungen anstreben). Sie werden aber zu den Ausbildungsinteressierten gezählt. Die Gruppe schließt alle institutionell erfassten Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit ein, die sich im Laufe des Berichtsjahres, zumindest zeitweise, für die Aufnahme einer dualen Berufsausbildung interessierten und deren Eignung hierfür festgestellt wurde, sei es über die Eintragung ihrer Ausbildungsverhältnisse bei den zuständigen Stellen oder – sofern sie nicht in eine Ausbildung einmündeten – im Rahmen ihrer Registrierung als Ausbildungsstellenbewerber/-innen bei den Beratungs- und Vermittlungsdiensten.
Durch den rechnerischen Bezug der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge auf die Zahl der institutionell erfassten Ausbildungsinteressierten lässt sich die Beteiligungs- bzw. Einmündungsquote ausbildungsinteressierter Personen in duale Berufsausbildung (EQI) ermitteln. Sie informiert darüber, wie hoch der Anteil unter den ausbildungsinteressierten Jugendlichen ausfällt, der letztlich für den Beginn einer dualen Berufsausbildung gewonnen werden konnte.
Als Indikator für erfolglose Marktteilnahmen werden darüber hinaus „Erfolglosenanteile“ berechnet. Der Anteil der gemeldeten unbesetzten Berufsausbildungsstellen am betrieblichen Gesamtangebot und der Anteil der noch eine Ausbildungsstelle suchenden Bewerberinnen und Bewerber an der Gesamtnachfrage sind wichtige Größen, um zu bewerten, wie gut die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage am Ausbildungsmarkt gelingt. Je nach Ausprägung des Anteils an unbesetzten Berufsausbildungsstellen und an noch suchenden Bewerberinnen und Bewerbern werden drei Problemtypen beschrieben: Versorgungsprobleme, Besetzungsprobleme und die Kombination aus beiden (= Passungsprobleme). Quantitativ lässt sich das Ausmaß der Passungsprobleme durch Multiplikation der Erfolglosenanteile auf den beiden Seiten des Ausbildungsmarktes abbilden. Der „Index Passungsprobleme“ (IP) berechnet sich somit als Produkt aus dem Prozentanteil der unbesetzten Stellen am betrieblichen Ausbildungsplatzangebot und dem Prozentanteil der noch eine Ausbildung suchenden Bewerber/-innen an der Ausbildungsplatznachfrage.
Zu beachten ist, dass nur diejenigen unbesetzten Berufsausbildungsstellen und noch eine Ausbildungsstelle suchenden Bewerber/innen berücksichtigt werden können, die der BA auch gemeldet sind. Die Inanspruchnahme der Dienste der Agenturen für Arbeit und Jobcenter ist für junge Menschen und für Betriebe freiwillig.
Die für die Ausbildungsmarktberichterstattung zentralen Indikatoren lassen sich nach Ländern und auf Arbeitsagenturbezirksebene ausweisen. Weitere Differenzierungen sind möglich nach Berufen, Zuständigkeitsbereichen (Industrie und Handel, Handwerk usw.), Finanzierungsform der Ausbildung (betrieblich, außerbetrieblich) und nach Geschlecht der ausbildungsinteressierten jungen Menschen.